Partnerschaft in der Pflege – Wenn die Liebe unter der Last zerbricht
Die Pflege eines Angehörigen verändert alles – auch die Beziehung zum eigenen Partner. Während Elternschaft meist beide betrifft und sich gemeinsam entwickeln kann, trifft die Pflege eines Elternteils oder Verwandten oft nur einen von beiden.
Die Belastung ist enorm – emotional, zeitlich und organisatorisch. Die Partnerschaft bleibt dabei nicht selten auf der Strecke.
Wenn Nähe zur Belastung wird
Pflegt einer der Partner regelmäßig die eigenen Eltern oder einen anderen nahestehenden Menschen, wird der Alltag um die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen herumgebaut. Der andere Partner bleibt außen vor – nicht aus böser Absicht, sondern weil Pflege kein Gemeinschaftsprojekt ist wie die Erziehung eines Kindes.
Während bei kleinen Kindern beide Eltern von Anfang an gefordert und integriert sind, steht bei der Pflege meist nur eine Person in der Verantwortung. Die Beziehung gerät dadurch aus dem Gleichgewicht: Der pflegende Part ist dauerhaft überlastet, emotional gebunden und körperlich erschöpft. Der nicht-pflegende Part fühlt sich abgelehnt, ausgeschlossen – oder sogar überfordert, weil er die Situation gar nicht richtig einschätzen kann.
Wenn einer Kinder hat – und einer pflegt
Auch Patchwork-Partnerschaften stehen vor Herausforderungen: Wenn einer der Partner ein Kind oder mehrere mitbringt, verschieben sich ebenfalls Rollen und Verantwortlichkeiten. Doch so herausfordernd diese Konstellation auch sein kann – sie ist in unserer Gesellschaft normalisiert.
Der Umgang mit Kindern ist vertraut, vorhersehbar, sozial eingebettet. Kita, Schule, Freizeitangebote, sogar gemeinsame Urlaube lassen sich organisieren. Wer Kinder mit in eine Beziehung bringt, wird in der Regel unterstützt, nicht infrage gestellt.
Ganz anders sieht es aus, wenn jemand Pflegeverantwortung mit in die Beziehung bringt. Da gibt es keine Spielgruppe, keine gemeinsamen Ausflüge – stattdessen Arzttermine, Inkontinenz, Demenz, Schmerz, Scham.
Der pflegende Partner ist in Gedanken oft ganz woanders, muss jederzeit abrufbar sein, kann selten abschalten. Für die Beziehung bleibt wenig Platz – und noch weniger Verständnis vom Umfeld.
Während die Kinderphase als gemeinsames Lebensprojekt gesehen wird, erscheint die Pflege wie eine zusätzliche Last, die von außen kommt und die Beziehung einseitig überfordert.
Der nicht pflegende Partner fühlt sich schnell ausgeschlossen, manchmal sogar überflüssig. Und der pflegende Part steht dazwischen – mit schlechtem Gewissen, überforderter Seele und dem tiefen Wunsch nach einem normalen Leben.
Pflege ist kein Alltag mit Baby
Oft werden Parallelen zwischen Pflege und der Versorgung kleiner Kinder gezogen. Doch das ist ein Trugschluss: Ein Baby wird größer, lernt zu laufen, zu sprechen, sich selbst zu versorgen. Pflege bedeutet hingegen Rückschritt, oft auch Kontrollverlust, Würdeverlust – und vor allem: keine Perspektive auf Besserung.
Der Alltag ist geprägt von Unplanbarkeit, Nachtwachen, medizinischen Anforderungen und emotionaler Daueranspannung. Während Eltern oft auf eine große gesellschaftliche Unterstützung zählen können, fühlen sich Pflegende allein gelassen. Und wer seine Zeit der Pflege widmet, wird eben nicht als „Held des Alltags“ gefeiert – sondern oft belächelt oder gar bemitleidet.
Keine Zeit für Partnerschaft
Pflegende Angehörige sind oft Singles – nicht aus Überzeugung, sondern weil in ihrem Alltag kein Platz für eine Partnerschaft bleibt. Wer rund um die Uhr sorgt, kann keine Dates wahrnehmen, keine tiefen Gespräche führen, keine Nähe aufbauen. Der Schlaf wird nachts mehrmals unterbrochen, wenn man zuhause pflegt.
Gleichzeitig könnten Nähe und emotionale Unterstützung so wichtig sein: ein Mensch, der zuhört, tröstet, den Blick von außen bietet. Doch selbst wenn sich eine Partnerschaft ergibt, bleibt ein Kernproblem: Die pflegende Person kann sich oft nicht wirklich einlassen und ist einfach besetzt. Sie muss zwischen Pflege, Haushalt, Organisation und emotionaler Stabilität „funktionieren“. Und das lässt kaum Raum für Zweisamkeit.
Oft ist dann auch das Thema Familienplanung beendet. Während andere Paare noch weiteren Nachwuchs planen, sehen pflegende Angehörige, dass ein Baby in dieser Situation nicht mehr in Frage kommt.
Unsichtbare Last, sichtbare Folgen
Partnerschaften in der Pflegezeit sind selten unbelastet – sie brauchen klare Kommunikation, Verständnis und auch Grenzen. Doch vor allem brauchen sie gesellschaftliche und strukturelle Unterstützung: Pflege sollte nicht die gesamte Lebenswelt dominieren. Es sollte noch Raum für alte und neue Beziehungen sein – ohne dass sich Pflegende dafür zerreißen müssen.
Die Realität sieht so aus, dass Pflegende Angehörige die Situation einfach so hinnehmen. Sie vernachlässigen automatisch ihren Partner, weil es einfach nicht anders geht oder sie nehmen ihr Single-Dasein hin, wohlwissend, dass eine Partnerschaft kaum zu organisieren wäre.
Auch dieser Umstand wird von allen zuständigen Behörden etc. einfach so hingenommen und für selbstverständlich erklärt.
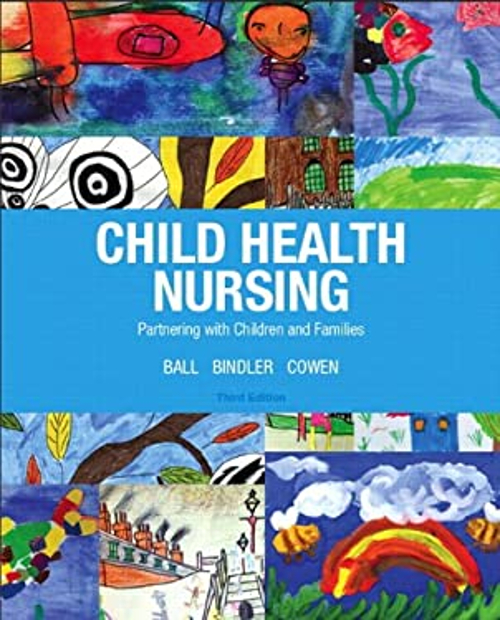
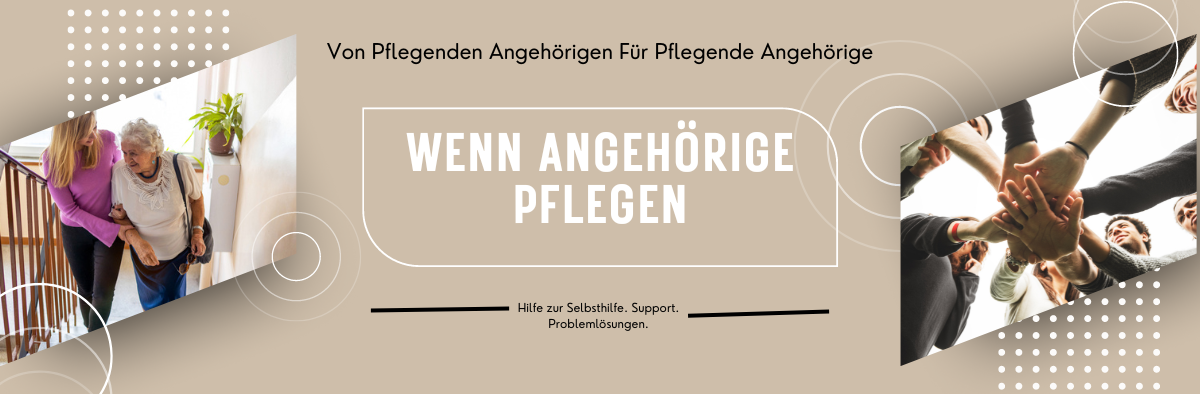




Neueste Kommentare