Gewichtszunahme bei pflegenden Angehörigen und Pflegekräften – warum Pflege oft auf die Figur schlägt
Viele Pflegende Angehörige nehmen während der Pflegezeit auffällig an Gewicht zu. Wie kann das sein, wo der Alltag doch so arbeitsintensiv und mit Bewegung verbunden ist? Wir erklären warum.
Pflege ist eine Aufgabe, die nicht nur körperlich, sondern auch seelisch viel abverlangt. Wer schon einmal über längere Zeit einen Angehörigen gepflegt oder im Beruf als Pflegekraft gearbeitet hat, weiß, wie schnell man selbst dabei in den Hintergrund rückt. Der Tagesablauf richtet sich fast ausschließlich nach den Bedürfnissen der pflegebedürftigen Person.
Essen, Bewegung, Schlaf – alles passt man an den Pflegealltag an. Und genau das führt häufig dazu, dass sich im Laufe der Zeit auch die eigene Figur verändert. Viele Pflegende bemerken, dass sie zunehmen, ihre Kleidung enger sitzt und sich ein Gefühl der „Schwere“ breitmacht. Doch woran liegt das?
Bewegungsmangel trotz körperlicher Arbeit in der Pflege
Auf den ersten Blick könnte man meinen, Pflege sei so bewegungsintensiv, dass sie das Gewicht eher stabil hält oder sogar reduziert. Schließlich sind Pflegekräfte viel auf den Beinen, helfen beim Umlagern, Heben oder Waschen. Doch diese körperlichen Tätigkeiten sind oft einseitig und beanspruchen nur bestimmte Muskelgruppen.
Sie ersetzen weder sportliche Bewegung noch fördern sie den Kreislauf so wie ein Spaziergang oder gezieltes Training. Pflegende Angehörige verbringen oft lange Stunden im Sitzen – etwa beim Füttern, beim Betreuen und Beaufsichtigen oder beim Ausfüllen von Formularen. Diese Mischung aus punktuell hoher körperlicher Belastung und ansonsten eher statischer Tätigkeit ist kein idealer Kalorienverbraucher.
Ungesunde Essgewohnheiten im Pflegealltag
Ein weiterer Faktor ist das Essverhalten, das sich durch die Pflege oft grundlegend verändert. Viele essen hastig, zwischendurch und nicht unbedingt das, was sie eigentlich brauchen. Statt ausgewogener Mahlzeiten landen schnell belegte Brötchen, Schokoriegel oder Fertiggerichte auf dem Teller, einfach weil sie sich ohne Aufwand essen lassen.
Manche essen auch mit, wenn die pflegebedürftige Person isst – selbst wenn sie eigentlich keinen Hunger haben. Das passiert aus Gemeinschaftsgefühl oder schlicht, um Reste nicht wegwerfen zu müssen. Gleichzeitig gibt es oft keine festen Essenszeiten mehr, der Körper bekommt mal zu viel, mal zu wenig Nahrung.
Stress, Cortisol und Gewichtszunahme
Stress spielt ebenfalls eine große Rolle. Die ständige Verantwortung, Sorgen um den Gesundheitszustand des Pflegebedürftigen, Zeitdruck und oft auch Schlafmangel setzen den Körper unter Daueranspannung. Dabei schüttet er vermehrt das Stresshormon Cortisol aus – und das begünstigt die Einlagerung von Fett, besonders im Bauchbereich.
Hinzu kommt, dass viele Menschen unter Stress zu sogenannten „Trostessern“ werden: Ein Stück Schokolade, ein süßer Kaffee oder ein Stück Kuchen geben kurzfristig ein Gefühl von Entspannung und Belohnung, auch wenn sie auf lange Sicht das Gewicht nach oben treiben.
Schichtdienst, Schlafmangel und Heißhunger
Wer im Schichtdienst arbeitet, etwa im Krankenhaus oder Pflegeheim, steht vor einem weiteren Problem: Der wechselnde Biorhythmus bringt den Hormonhaushalt durcheinander. Das Sättigungshormon Leptin sinkt, während das Hungergefühl-Hormon Ghrelin steigt – man hat also mehr Appetit und greift besonders gern zu kalorienreichen Lebensmitteln. Nachtarbeit erschwert zudem einen gesunden Schlaf, was wiederum den Stoffwechsel verlangsamt.
Psychologische Ursachen: Der „Schutzpanzer“-Effekt
Neben diesen körperlichen und hormonellen Ursachen gibt es auch einen psychologischen Aspekt: Manche Pflegende beschreiben ihre Gewichtszunahme als eine Art „Schutzpanzer“. Unbewusst empfinden sie eine kräftigere Statur als Signal für Stärke oder Distanz, was in einem Umfeld, das oft emotional sehr belastend ist, eine Art Selbstschutz darstellen kann.
Selbstfürsorge in der Pflege nicht vergessen
All diese Faktoren zusammen – Bewegungsmangel trotz körperlicher Arbeit, unregelmäßiges und oft ungesundes Essverhalten, Stress, Schlafmangel und psychische Belastungen – ergeben einen Teufelskreis, aus dem man nur schwer wieder herauskommt. Wichtig ist zu verstehen, dass diese Gewichtszunahme nichts mit mangelnder Disziplin zu tun hat, sondern eine natürliche Reaktion auf die besonderen Bedingungen des Pflegealltags ist.
Wer für andere da ist, muss sich selbst nicht perfekt in Form halten, aber das eigene Wohlbefinden sollte nicht aus den Augen geraten. Kleine, machbare Veränderungen – ein vorbereiteter gesunder Snack, ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft oder bewusste Pausen – können helfen, den Körper zu entlasten und sich wieder wohler zu fühlen.
Pflege bedeutet Fürsorge für andere – doch sie sollte nicht bedeuten, die Fürsorge für sich selbst zu vernachlässigen. Wer beides in Balance bringt, schützt nicht nur seine Gesundheit, sondern kann die anspruchsvolle Aufgabe der Pflege auch länger mit Kraft und Energie bewältigen.
Wir alle wissen, dass dies leichter gesagt ist, als getan. Besonders wenn die Pflege Tag und Nacht erfolgt, also man auch nachts in Bereitschaft schläft, ist der Körper gründlich durcheinander. Oft schafft man es nicht, sich während der Pflegezeit ausreichend um den eigenen Körper zu kümmern. Wer sich Zeit freischaufeln kann, sollte versuchen ins Gym zu gehen, denn dort kann man mit Gewichttraining die einseitige Belastung ausgleichen. Es sind auch angenehme Auszeiten vom Pflegealltag.
Leider reicht das oft auch nicht unbedingt aus, wenn man etwa 2x die Woche geht um die Gewichtszunahme in der Pflegezeit zu verhindern. Es ist oft einfach eine fast logische Folgerung für die Überbelastung. Und wer nur zunimmt, aber nicht krank, in dieser herausfordernden Zeit, kann eigentlich froh sein.
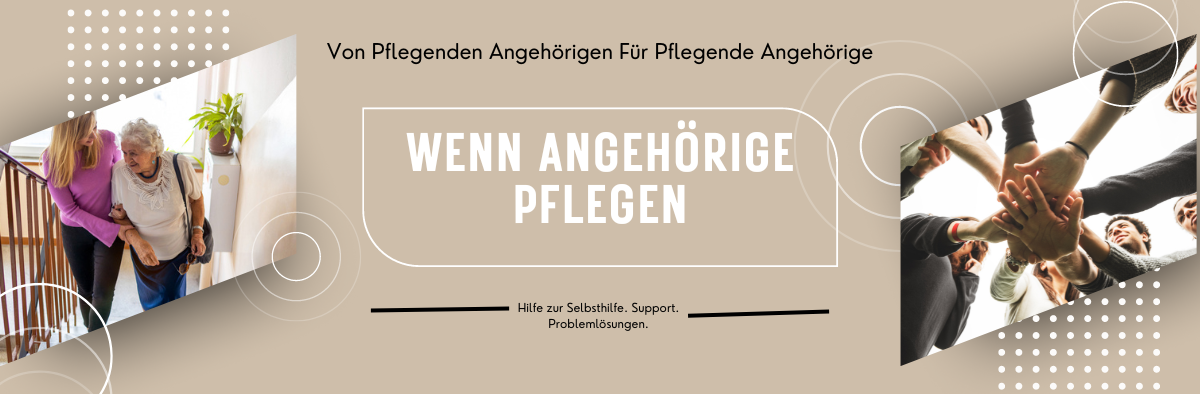



Neueste Kommentare